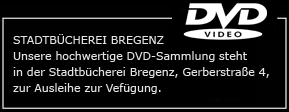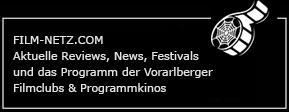Filmforum Archiv
Im Rahmen der Filmtage zum Recht auf Nahrung – Hunger.Macht.Profite. wird dieses Portrait einer Bäuerin von Steinbach am Attersee in Oberösterreich gezeigt. Vierzehn Mutterkühe, die Kälber, zwei Schweine zum Eigenverzehr, ein paar Hühner, Wiesen und Wald. Der Hof der Bäuerin Christine Pichler-Brix ist klein, tausend Euro wirft er im Monat ab. Der Großteil davon sind EU-Förderungen. Was hindert Christine und ihre Familie daran aufzugeben, so wie jährlich fünftausend KleinbäuerInnen österreichweit? Christine ist die erste Bäuerin nach über 250 Jahren und führt den Hof nach ihren Vorstellungen. Ihre Leidenschaft für die Landwirtschaft motiviert sie für die täglichen Arbeiten, die ein kleiner Hof benötigt. Mit Lebensfreude und Freiheitsgefühl führt sie den Hof in eine neue Zeit, und engagiert sich bei ÖBV - Via Campesina gegen das Verschwinden kleinbäuerlicher Strukturen.
Im Anschluss sprechen ExpertInnen über lokale Initiativen und Handlungsoptionen.
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit im Rahmen der Initiative Hunger.Macht.Profite.
In Kooperation mit dem Verein Bodenfreiheit, Bio Austria und dem Obst- und Gartenbauverein
Im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise Ende 2015 werden die einst offenen Grenzen Europas auch innerhalb der Europäischen Union wieder geschlossen. Als „bauliche Maßnahme“ bezeichnen die ehemalige österreichische Innenministerin und der damalige Bundeskanzler Grenzzäune, die entlang der slowenischen Grenze gebaut werden. Und als 2016 syrische Flüchtlinge vermehrt über die gefährliche Mittelmeerroute nach Italien aufbrechen, befürchtet die österreichische Politik einen Ansturm auf die italienisch-österreichische Brennergrenze und kündigt symbolträchtig die Errichtung einer weiteren baulichen Maßnahme am Brenner an.
Nikolaus Geyrhalter beschäftigt sich in diesem Film mit der Grenzregion Brenner und mit den BewohnerInnen, während ein politischer Beschluss, der auf Befürchtungen (und Spekulationen) und Angst basiert, droht, nicht nur auf die Region, sondern auf ganz Europa Auswirkungen zu haben. Was bedeutet eine solche Maßnahme (= ein Grenzzaun) für die BewohnerInnen? Wie schreibt sich diese Veränderung in den Ort und die Lebensgeschichten ein? Wie verändert der Ruf nach Grenzen, die vor mehr als 20 Jahren mit großem Pomp und unter Anteilnahme der Politik abgeschafft wurden, das Denken der Menschen? (filmladen)
Großer Diagonale-Preis 2018, Bester Dokumentarfilm
De helaasheid der dingen
BE, NL 2009, 105min, OmU, R: Felix Van Groeningen
Das Leben bei den Strobbes ist hart, herzlich und hochenergetisch – und immer wieder auch von herrlich komischen Momenten durchzogen. Trotzdem kann einem der junge Gunther Strobbe leid tun, wie er seine Jugendjahre da unter einem Dach mit seinem Vater und dessen trinkfreudigen Brüdern verbringt. Die Angst, so zu werden wie seine Verwandtschaft, beschäftigt Gunther auch als Erwachsener. Droht ihm ein ähnliches Schicksal?
Der flämische Regisseur Felix Van Groeningen hat die Verfilmung des auf autobiografischen Erfahrungen beruhenden Romans von Dimitri Verhulst (auch auf Deutsch unter dem gleichnamigen Titel erschienen) nicht als Sozialdrama, sondern wie im Buch als sehr persönliche Familiengeschichte angelegt. „Die Beschissenheit der Dinge“ schildert ebenso realistisch wie auch vergnüglich das Dilemma, die Dämonen der Vergangenheit hinter sich zu lassen. In diesem Sinne: Willkommen bei den Strobbes.
"Schonungslos und brüllend komisch." Variety
"Von Leben durchtränkt - Bravo!" Jean-Pierre & Luc Dardenne
„…bittersüß und ebenso unflätig wie poetisch. In Cannes gab es dafür den Prix Art et Essai.“
Die beste aller Weltenist die wahre Geschichte einer drogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Kindes und ihrer Liebe zueinander. Adrian erlebt eine Kindheit in einem außergewöhnlichen Milieu, der Salzburger Drogenszene, und mit einer Mutter zwischen Fürsorglichkeit und Drogenrausch. Wenn er groß ist, möchte er Abenteurer werden. Trotz allem ist es für ihn eine behütete Kindheit, die beste aller Welten, bis sich die Außenwelt nicht mehr länger aussperren lässt. Helga weiß, sie muss clean werden, um ihren Sohn nicht für immer zu verlieren. Doch dazu muss sie ihre eigenen Dämonen besiegen…
Regisseur Adrian Goiginger erzählt in diesem Debütfilm seine eigene Geschichte und schafft damit eine Hommage an seine Mutter, eine starke Frau, trotz aller widrigen Umstände… Mit dem österreichischen Shooting Star Verena Altenberger, für ihre Rolle in diesen Film ausgezeichnet als beste österreichische Schauspielerin, und Jeremy Miliker.
„Ein vortreffliches Beispiel, dass Drama und Publikums-Liebling einander nicht ausschließen müssen.“ (Wiener Zeitung)
Berlinale 2017, Sektion “Perspektive Deutsches Kino”: Kompass-Perspektive-Preis
Vienna Film Awards 2017: Young Director Award
Diagonale 2017: Beste Schauspielerin, Bestes Szenenbild, Publikumspreis
Mitten in der tiefsten Lebenskrise wird dem Holocaust-Forscher Toto eine Assistentin zur Kongress-Vorbereitung zugeteilt – Zazie, jüdischer Herkunft und mit ausgeprägter Teutonen-Phobie. Der Stargast des Kongresses, eine berühmte Schauspielerin, zieht plötzlich die Zusage zurück, und zwischen Totos und Zazies Biografien tauchen bizarre Verbindungen auf.
Chris Kraus verbindet in Die Blumen von Gesternauf seine eigene,
leidenschaftliche Art Komödie mit einem zutiefst berührenden Drama. In den Hauptrollen brillieren Lars Eidinger, wie man ihn noch nie gesehen hat, und die sensationelle Adèle Haenel, weltweit gefragter französischer Shooting-Star.
29. Tokyo International Film Festival 2016: Hauptpreis Tokyo Grand Prix und Publikumspreis
Johanna Dohnal (14.2.1939 – 20.2.2010) war nicht nur eine Politikerin, die für Frauen und Mädchen in Österreichs konservativer Gesellschaft die gesetzlichen und sozialen Rahmenbedingungen grundlegend verbessert hat, sie war eine Feministin und Visionärin, die leider viel zu früh an der Umsetzung ihrer Visionen gehindert wurde. Anders auf den Punkt gebracht: „Johanna Dohnal war eine lesbisch-feministische Superheldin.“ (Katja Wiederspahn in: viennale.at)
„Sabine Derflinger hat in Die Dohnal der unermüdlichen Kämpferin und Wegbereiterin der Frauensache ein vielstimmiges Portrait gewidmet.“ (Karin Schiefer, AFC)
„Der Film ist genau das geworden, was ich mir gewünscht hatte: es sollte ein Film werden, in dem sich die Generationen begegnen, einer, der Johanna Dohnal lebendig werden lässt und ein Film, der Feminismus begreifbar macht, nämlich nicht als etwas, das man als Hobby betreibt, sondern etwas, das ein grundlegendes Menschenrecht darstellt, das sich absurderweise noch immer nicht durchgesetzt hat.“ (Sabine Derflinger)
Großer Diagonalepreis 2020, Bester Dokumentarfilm
In Kooperation mit dem Verein Amazone und dem Frauenmuseum Hittisau
Winona LaDuke
DE 2003 | 73 min | Dt. Fassung | R: Claus Biegert,...
Wo ist Winona? Eine Frage, die zu ihren "besonderen Merkmalen" gehört. Denn Winona LaDuke ist selten da, wo man sie vermutet. Sie ist die Tochter einer jüdischen Malerin und eines indianischen Stuntman vieler Hollywood-Western, der später als Sun Bear in der New-Age-Bewegung von sich reden machte. Sie sprach mit 17 Jahren vor der UNO in Genf und studierte in Harvard Ökonomie. Ihre väterliche Welt der Anishinaabeg wirkte stärker als die jüdische der Mutter und so ließ sie sich nach dem Studium in White Earth nieder, dem Heimatreservat ihres Vaters im Bundesstaat Minnesota, dem "Land der zehntausend Seen".
Die Aktivistin Winona vereinte Indianerbewegung und Umweltinitiativen und war die erste Ureinwohnerin, die in den Vorstand von Greenpeace gewählt wurde. Das Magazin TIME zählte sie in den Neunziger Jahren zu den 50 Führungspersönlichkeiten unter 40, auf die man am meisten hoffen könne. Sie gilt als charismatische Rednerin auf internationalen Konferenzen, sofern sie nicht gerade ein Buch schreibt, Wildreis erntet, gegen Uranabbau und Genmanipulation kämpft, Geld zum Rückkauf gestohlenen Reservatslandes sammelt, auf Powwows tanzt, ihre Kinder unterrichtet oder Pesto mixt.
Was tun, wenn man erfährt, dass man ein behindertes Kind erwartet? Ausgehend von dieser Frage entwickelt Thomas Fürhapter seinen komplexen filmischen Essay: Die dritte Option setzt Einzelschicksale im Zeitalter von Pränataldiagnostik und Biopolitik in einen radikal gegenwärtigen und gesellschaftspolitischen Zusammenhang. Schicht um Schicht wird der Blick freigeräumt auf grundsätzliche Fragen zu Geburt, Ethik und Norm – so wird das, was nur wenige betrifft, zu etwas, das alle angeht.
„Mutig und unbequem.“ Der Falter
„Ein faszinierender, gespenstischer Kino-Essay zur Pränataldiagnostik.“ profil
Wirtschaftsanwalt Urs Blank ist der unangefochtene Star auf seinem Gebiet. Er ist erfolgreich, hat Geld und die für ihn perfekte Frau. Der Selbstmord eines Geschäftskollegen wirft Urs jedoch aus der Bahn. Er fängt an, sein bisheriges Leben in Frage zu stellen. Vielleicht auch deshalb fühlt er sich so zu Lucille hingezogen, die ihm mit ihrem alternativen Lebensstil eine ganz neue Welt eröffnet – und ihn zu einem Trip mit halluzinogenen Pilzen verführt. Mit Folgen für Blank, denn nach dem Trip verändert sich seine Persönlichkeit und bringt seine dunkle Seite zum Vorschein.
Mit fiebriger Spannung nimmt der Film den Zuschauer mit auf den Psychotrip eines Mannes, der das Gleichgewicht verliert auf dem schmalen Grat zwischen Normalität und Wahnsinn, zwischen dem ganz alltäglichen Leben und dem unkontrollierten Durchbrechen verborgener Instinkte. Mit einer fesselnden darstellerischen Tour de Force begeistert Moritz Bleibtreu in der Rolle des Urs Blank. Ein schauspielerisches Duell der Sonderklasse liefert er sich dabei mit Jürgen Prochnow, der mit kühler Bösartigkeit Blanks Widersacher Pius Ott spielt.
„Ein ungeheuer dichter, spannungsgeladener Thriller. Das ist richtig tolles Kino!“ (Programmkino.de)
CH 2018 | 99 min |Doku | R: Thomas Haemmerli
Die Gentrifizierung bin ich. Beichte eines Finsterlings“ macht sich lustig. Über alles und jeden. Über die Linken, die alles bewahren wollen und sich vor Fortschritt fürchten. Über die Rechten, die jammern, der Fremde nehme ihnen Wohnung, Arbeit und den letzten Eisenbahn-Sitzplatz weg. Der Essay streitet für dichte, vertikal gebaute Städte und erklärt die 20-Millionen-Metropole São Paulo zum Vorbild für die Schweiz. Er folgt der Wohnvita des Autors, der früher besetzte und heute im Trendquartier besitzt, der weltweit Wohnungen sammelt und sich damit selbst zum Gentrifizierungs-Schurken macht.
Regisseur Thomas Haemmerli entführt in Weltmetropolen wie Tiflis, São Paulo und Mexiko-Stadt. Und er untersucht, warum in den Schweizer Städten Wohnungen so teuer sind, obwohl überall Baukräne stehen. Ohne je die Moralkeule zu schwingen fragt er, warum allerorten renoviert wird und die Mieterschaft plötzlich auf der Strasse steht. Ein rasant geschnittener, innovativ gestalteter Film – humorvoll, selbstironisch, provokant.
„Warum lebt die Grosszahl der Schweizer eigentlich im ersten bis dritten Stock? Warum wollen wir keine Wolkenkratzer? Und warum sieht Zürichs Innenstadt immer noch so putzig aus wie im vorletzten Jahrhundert? Thomas Hämmerli weiß wieso - und warum es sich nicht ändert. Als kommunikativer Verdichter mit globaler Präsenz nimmt er sich an der Nase und Städteplanung unter die Lupe. Mit Ironie und Knalleffekten. Aber immer witzig und prägnant.“ (Outnow.ch)
Eine Filmvorführung im Begleitprogramm zur Ausstellung des Jüdischen Museums Hohenems „Am Rand. Zusammen leben in der Untergass'“ mit einer kurzen Einführung in den Film von Anika Reichwald (Jüdisches Museum Hohenems).
Wir zeigen den Film in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Hohenems und dem vai Vorarlberger Architektur.
Zurich Film Awards 2018, Bester Dokumentarfilm
Zürich Film Fesival 2017, Special Mention in der Kategorie International Documentary Film
Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrem Mann und zwei Söhnen in einem beschaulichen Schweizer Dorf lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Ganz im Gegenteil: Es herrscht die Meinung, Emanzipation sei ein Fluch, eine Sünde gegen die Natur und schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Als Nora wieder anfangen möchte zu arbeiten, verweigert ihr Mann ihr die Erlaubnis und beruft sich dabei auf das Ehegesetz, das die Frau dazu verpflichtet, sich um den Haushalt zu kümmern. Hier erwacht Noras Widerstand! Sie beginnt feministische Literatur zu lesen, enge Jeans und wilden Pony zu tragen und besucht einen Workshop für sexuelle Befreiung. Als sie sich aktiv für das Frauenstimmrecht einsetzt und zu einem Streik aufruft, gerät der Dorf- und Familienfrieden gehörig ins Wanken...
In der charmanten und warmherzigen Komödie über den Kampf um Gleichberechtigung und die Einführung des Schweizer Frauenstimmrechts treffen chauvinistische Vorurteile und echte Frauen-Solidarität aufeinander.
„Gehen Sie ins Kino und schauen Sie Die göttliche Ordnung an.“
(Die Zeit)
Schweizer Filmpreis 2017: Beste Darstellerin, Beste Nebendarstellerin, Bestes Drehbuch
Tribeca Filmfestival 2017: Publikumspreis, Preis der Jury für die beste Schauspielerin
Um seine Mutter mit beginnender Demenzerkrankung zu pflegen, zieht der erfolgreiche Magazinfotograf Michael Appelt mit Anfang fünfzig wieder in sein altes Kinderzimmer ein.
Appelt, der nach einem langen Krankenhausaufenthalt selbst traumatisiert ist und an einer schweren Depression leidet, kümmert sich liebevoll um die Mutter und träumt von früheren Abenteuern, als seine von der Fotografie dominierte Welt noch in Ordnung war.
Reiner Riedlers Dokumentarfilm ist ein persönliches Porträt über einen Freund und Wegbegleiter, das nicht bloß von essenziellen Themen des Menschseins, des Älterwerdens und der Konfrontation mit dem Ausweglosen erzählt, sondern darüber hinaus auch Michael Appelts eindrückliches fotografische Oeuvre zugänglich macht.
Zuvorderst ist Die guten Jahre aber eines: Das filmische Zeugnis einer bedingungslosen Liebe, die Mutter und Sohn Grundlage für ein Zusammenleben in Zeiten des Wandels ist.
Medienpartnerschaft: Aktion Demenz, SOB – Schule für Sozialbetreuungsberufe