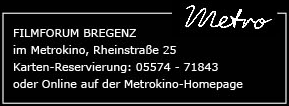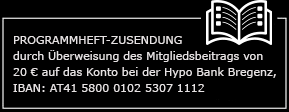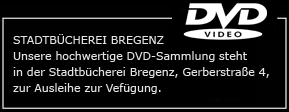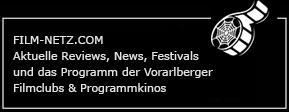Filmforum Archiv
Graz 1963. Der angesehene Lokalpolitiker und Großbauer Franz Murer steht wegen schwerer Kriegsverbrechen, begangen in seiner Zeit als Leiter des Ghettos von Vilnius 1941-43, vor Gericht. Die Beweislage ist erdrückend. Aber in den Zentren der Macht will man die dunklen Kapitel der eigenen Geschichte endgültig abschließen.
Murer – Anatomie eines Prozesses rekonstruiert, basierend auf den originalen Gerichtsprotokollen, den Prozess gegen den bestens beleumundeten Franz Murer.
„Die Bewohner des Ghettos von Vilnius gaben ihm den Beinamen „Der Schlächter von Wilna“. Nur 600 von 80.000 Juden überlebten die dortige NS Herrschaft. Das Gerichtsverfahren, zu dem Überlebende aus der ganzen Welt anreisten, deren Zeugenaussagen kaum Zweifel an Murers Schuld zuließen, zählt zu einem der größten Justizskandale der Zweiten Republik.“ (film.at)
„Christian Froschs Drama ist ein mutiges Statement und eine klare Botschaft gegen die Vergessens- und Verdrängungskultur wie sie tief in der österreichischen Seele verwurzelt ist und skizziert eine Welt, in der Gerechtigkeit und Genugtuung nicht existent sind.“ (uncut.at)
Großer Diagonale Spielfilmpreis 2018
Sommer in einem türkischen Dorf. Lale und ihre vier Schwestern wachsen nach dem Tod der Eltern bei ihrem Onkel auf. Als sie nach der Schule beim unschuldigen Herumtollen mit ein paar Jungs im Meer beobachtet werden, lösen sie einen Skandal aus. Ihr als schamlos wahrgenommenes Verhalten hat dramatische Folgen: Das Haus der Familie wird zum Gefängnis, Benimmunterricht ersetzt die Schule und Ehen werden arrangiert. Doch die fünf Schwestern – allesamt von großem Freiheitsdrang erfüllt – beginnen, sich gegen die ihnen auferlegten Grenzen aufzulehnen.
Einfühlsam und kraftvoll zugleich setzt die junge Regisseurin Deniz Gamze Ergüven die unzähmbare Lebenslust der fünf Schwestern in Szene, die sich in einer von Männern geprägten Gesellschaft ihr Recht auf Selbstbestimmung erkämpfen. Mit lichtdurchfluteten Bildern trotzt der Film dem dramatischen Geschehen und setzt der Brutalität zarte Sinnlichkeit und jugendliches Aufbegehren entgegen.
„In betörenden und kraftvollen Bildern fängt der Film den Geist von Freiheit und Rebellion ein, der in einer Generation junger Frauen nistet, die sich gegen das System der Zwangsehe auflehnen.“ (epd-film)
Europäischer Filmpreis 2015, Entdeckung des Jahres | Vielfach ausgezeichnet in Cannes, Hamburg Odessa, Palm Springs, Philadelphia, Sarajevo
Mein Leben ohne mich
CA, ES 2003 | 102 min | OmU | R u B: Isabel Coixet
Die 23-jährige todkranke Ann beschließt, ihr verbleibendes Leben ganz bewusst zu genießen und heimlich und leise für ihre Familie die Zeit nach ihrem Tod vorzubereiten.
Trotz des herausfordernden Themas kein Melodram, sondern das Porträt einer Frau, die in einer ausweglosen Situation nicht den Lebensmut verliert und die antizipierte Trauer ihrer Umgebung über die eigene Verzweiflung stellt. Ein ernster, emotionaler Film, der letztlich Fragen nach den Grundlagen des Lebens stellt. Tragisch, tröstlich und keine Spur pathetisch: die einfühlsame Geschichte eines leisen Abschieds.
„Produziert von Pedro Almodóvar, war My Life without Meder Überraschungsfilm der Berlinale 2003. Einfühlsam erzählt Isabel Coixet von der Zerbrechlichkeit der Träume, dem Zurückgeworfensein auf sich selbst, aber auch von der Kraft der Liebe." (moviemento.at)
Barcelona Film Awards 2004: Bester Film, Beste Regie
Goyas 2004: Bestes Drehbuch, Bester Original Song
Die Wüste dehnt sich endlos aus – flach, grau, unerbittlich. Kein Baum, kein Grashalm, kein Stein. Eines aber gibt es im Überfluss: Salz, und zwar unter der ausgetrockneten, rissigen Erdoberfläche. Der Kleine Rann of Kutch ist eine 5.000 km² Salzwüste in der nordindischen Wüstenregion. Seit Generationen kommen die Salzbauern jährlich für acht Monate hierher, um das Salz mühevoll aus dem glühenden Boden zu ziehen. Diese schwere Arbeit hat die in Zürich lebende indische Regisseurin Farida Pacha mit ruhigen Einstellungen und leuchtenden Bildern dokumentiert.
In der gleißenden Einöde wird zu Beginn eine Gruppe von Männern, Frauen und Kindern abgesetzt. Sie beziehen eine dürftige Unterkunft und machen sich unverzüglich an die Arbeit. Unter schwierigsten Bedingungen wird das Salz gewonnen. Dabei müssen alle mithelfen, auch die Kleinsten.
Die mit ruhiger Kamera aufgenommenen Bilder sind von bestechender Klarheit, Einfachheit und Reinheit. Nachts sieht man den reinen Sternenhimmel, tags hört man das monotone Tuckern des Dieselmotors der Wasserpumpe für die Bewässerung der Salzfelder. Die Bilder werden nicht kommentiert, stattdessen hört man die Gespräche der Familienmitglieder oder die Anweisungen an Mitarbeiter und versteht die Situation.
Farida Pacha hat den gesamten schweißtreibenden Prozess der Salzgewinnung dokumentiert, von der Ankunft und dem Instandsetzen der Ausrüstung über den Abtransport auf die Fahrzeuge der Händler bis zum Vergraben der Maschinen und der Abfahrt. Ein beeindruckender filmischer Kreislauf. (nach: nzz.ch; cineman.ch)
„Die ergreifend schönen, aber nicht beschönigenden Bilder von Lutz Konermann machen Kommentare überflüssig. Wir sehen, wie Familien in einem in der Regenzeit zum Sumpf werdenden Gebiet das Salz aus dem Boden holen, wo tuckernde Dieselmotoren und vorzeitliche Hand- respektive Fußarbeit ineinander gehen und die Arbeit die Menschen ganz selbstverständlich restlos vereinnahmt. Und doch ziehen sich die Leute ihre besten Sachen an, weil nun die Kamera auf sie schaut, und man sieht mit Hoffnung, dass sie sich nicht abgeschrieben haben.“ (Stuttgarter Zeitung)
Der Film wurde vielfach bei Filmfestivals ausgezeichnet, darunter mit dem Firebird Award bei den Filmfestspielen von Hongkong 2014.
Im Sommer 1956 will der junge Oxford-Abgänger Colin Clark (Eddie Redmayne) in das Filmbusiness einsteigen und ergattert einen Job auf dem Set von „The Prince and the Showgirl“ mit Marilyn Monroe (Michelle Williams). Der Film basiert auf den Tagebüchern des Filmemachers Colin Clark, welche 40 Jahre nach den Ereignissen veröffentlicht wurden. In der ersten Fassung dieser Autobiografie fehlte eine Woche. Die Geschichte dieser Woche wurde später unter dem Titel My Week with Marilyn publiziert und nun endlich verfilmt.
Der Erstlingsfilm des britischen Regisseurs Simon Curtis bescherte Hauptdarstellerin Michelle Williams einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung.
Milchmann Kosta ist vom Glück gesegnet: Er passiert nicht nur Tag für Tag auf seinem Esel unversehrt die Frontlinie, sondern wird auch noch von der Dorfschönheit Milena als Bräutigam auserwählt. Doch dann verliebt sich Kosta Hals über Kopf in eine geheimnisvolle Italienerin, die allerdings schon dem Kriegshelden Zaga versprochen ist und zudem von ihrem rachsüchtigen Ex-Mann gejagt wird. Ohne nachzudenken brennen die beiden Liebenden durch und geraten in einen Strudel fantastischer Abenteuer. Zwischen burlesken Gestalten und rauschenden Festen im Balkan-Beat findet Kusturica mit Karacho zu alter Form zurück.
"Mit ungebremster Fabulierlust kehrt Emir Kusturica auf die Kinobühne zurück. Anspielungsreich, vieldeutig und mit großer visueller Wucht erzählt er eine Geschichte, die nur so wimmelt von barocken Figuren und eigenwilligen Überlebenskünstlern. Nichts ist real, doch vieles ist wahrhaftig in diesem kunstvollen Comeback, das an Kusturicas große Erfolge anknüpft." cinetastic
Luna und Amar sind ein verliebtes Paar. Sie haben begehrte Jobs und genießen das Leben im pulsierenden Alltag von Sarajevo. Sie ist als Flight Attendant viel in der Luft, und er verliert manchmal an Boden, wenn er ein Glas zu viel hebt. Als man ihn im Tower mit Schnaps im Kaffee erwischt, wird Amar suspendiert. Beim Ausflug zum Riverrafting trifft er auf einen alten Bekannten, findet durch ihn eine Anstellung in einer ultrakonservativen religiösen Gruppierung und beginnt sich zu verändern. Die lebensfrohe Luna versteht ihn immer weniger. Sie muss sich entscheiden, wie viel an eigenen Werten sie für die Liebe aufgeben will. Und sie fragt sich: Wie viel Religion erträgt der Mensch?
Jasmila Zbanic ("Grbavica") hat einen ebenso einfühlsamen wie hochgradig aktuellen Liebesfilm gestaltet.
"Differenziert und ohne moralischen Zeigfinger spiegelt die Filmautorin Jasmila Zbanic die Auswirkungen des religiösen Fanatismus im Nachkriegs-Bosnien in der Geschichte einer Entfremdung. Ein feinfühliger, starker Film!" NZZ am Sonntag
Nominierung für den Europäischen Filmpreis: Europäische Schauspielerin 2010 (Zrinka Cvitesic)
Filmfest München: Bernhard Wicki-Filmpreis (Quelle: polyfilm)
Das Leben könnte fabelhaft sein für Livia und Marco: Gutaussehend, jung und Eltern von Tim. Der ist 9 Monate und raubt ihnen mit seinem schrillen Gebrüll jede Nacht den letzten Nerv. Und das, obwohl er doch eigentlich die krisengeschüttelte Beziehung seiner Eltern kitten sollte. Statt Schlaf und Sex heißt es nun Nacht für Nacht: Raus aus den Betten, rein in die Jeans und in den rappeligen Golf, dessen Motorengeräusche das Einzige sind, was Tim zur Ruhe bringt. Eines Nachts passiert das Unfassbare: Ein kleinkrimineller Charmeur und sein Date klauen Auto – und Kind. Was Tim weiter friedlich schlummern lässt, versetzt seine Eltern in Angst und Schrecken – und wird zu einer irren Jagd durch die Nacht, in der geschrien, geschwiegen, gerast, gebremst und gewendet wird. Und vielleicht bringt der neue Tag ja tatsächlich auch eine Wende für Livia, Marco und Tim?
Bereits bei Giulias Verschwindenhat die Zusammenarbeit von Martin Suter, Regisseur Christoph Schaub und Produzent Marcel Hoehn zu einem wunderbaren und erfolgreichen Kinoerlebnis geführt.
Ausgezeichnet mit dem Publikumspreis beim Filmfestival Locarno 2009
Wir alle brauchen ein Zuhause. Aber muss man deshalb gleich zusammenleben? Was erfüllt uns heute noch? Woran glauben wir? Und wofür lohnt es sich zu kämpfen? In einer Welt, in der uns alle Möglichkeiten offen zu stehen scheinen. Wir leben im digitalen Zeitalter und zum Großteil in finanzieller Unabhängigkeit, alte Lebenskonzepte gelten kaum mehr. Ein Gefühl des Verloren seins macht sich breit inmitten einer zunehmend vernetzten Welt: Gibt es heute noch das traute Heim? Ein Zuhause, mit nur einem Partner? Also: Nägel mit Köpfen?
Um das zu erkunden, bricht Marko wieder zu einer persönlichen Entdeckungsreise auf: Er ist 35, fühlt sich noch immer nirgends angekommen und ist meilenweit davon entfernt, Vater zu werden. Woran liegt das? Denn eigentlich hätte er die richtige Frau dafür schon gefunden. Worauf wartet er also? Auf irgendein Zeichen, einen magischen Moment? Oder glaubt er tatsächlich, dass vielleicht noch etwas Besseres kommt?!
Die Fortsetzung des österreichischen Kultfilms Mein halbes Leben führt uns diesmal nach Wien, Berlin, Belgrad, Dubai und Addis Abeba: Nägel mit Köpfen ist ein ironisch-analytisches Generationenportrait und eine reale, bitter-süße Suche nach erfüllenden Partnerbeziehungen in unserer Zeit.
Der Film begleitet über mehrere Wochen den Eskimo Nanuk und seine Familie, die aus den beiden Ehefrauen Nyla und Cunayou, dem jungen Sohn Allee und dem viermonatigen Baby Rainbow besteht. Dokumentiert wird das alltägliche Leben und die Arbeit, wie Robben- und Walrossjagd, Fischfang, Iglubau, Fellhandel, Pflege der Kinder und Betreuung der Schlittenhunde. Neben der Schönheit der Natur und der naiven Fröhlichkeit der Menschen wird auch die Härte des arktischen Lebens festgehalten. Die Familie gerät bei einem plötzlichen Schneesturm in Lebensgefahr, und sie wird von Hunger und Verzweiflung geplagt.
Flaherty drehte die Dokumentation über das alltägliche Leben der Eskimo-Familie von Nanuk und Nyla nahe dem Ort Inukjuaqin der Arktisvon Québec, Kanada. Flaherty hat in dieser Region als Prospektor gearbeitet und dabei auch Filmaufnahmen gemacht, die er ab 1916 in Toronto in Privatvorführungen zeigte. Beim Verschiffen entzündete sich das Material von 9000 Meter, als Flaherty versehentlich Zigarettenasche auf die schnell entzündlichen Filme fallen ließ. Neuerliche Aufnahmen machte Flaherty − unterstützt von Revillon Freres − von August 1920 bis August 1921.
Der Protagonist Nanook trug den Namen Allakariallak. Er und seine Familie kamen bald nach der Fertigstellung des Films bei einem Schneesturm ums Leben.
Die Aufnahmen des Films waren teilweise inszeniert: So jagte Nanook noch mit seinen traditionellen Waffen, Allakariallak besaß aber bereits ein Gewehr. Diese Sachverhalt stieß später auf Kritik bei den Anhängern des Cinéma vérité.
In den 1980er Jahren wurde der Film, der lange Zeit nur in einer 48 Minuten langen Version zu sehen war, restauriert. (wikipedia)
Der Dokumentarfilm „Nanuk, der Eskimo“ gehört zu den ersten und bedeutendsten Dokumentationen der Stummfilm-Ära. (filmstarts.de)
Wir zeigen den Film in Kooperation mit dem vorarlberg museum. Vor dem Film gibt es um 18 Uhr eine Führung mit Nikolaus Walter durch seine Ausstellung im Museum. Das Kombiticket für Führung und Film kostet 12 Euro.
Janne könnte sich eigentlich den Strick nehmen. Wie es schon viele vor ihm in seinem Dorf am Polarkreis getan haben. Weil dort das Analog-TV abgestellt wird, gibt ihm seine Freundin Inari Geld für einen Digitalempfänger. Als Janne dieses versehentlich für Bier ausgibt, wird Inari stocksauer und stellt ihm ein Ultimatum: Entweder er besorgt das Elektrogerät bis zum nächsten Morgen oder es ist Schluss. Zusammen mit seinen Kumpels Ralle und Kanne begibt er sich auf eine nächtliche Odyssee durch Lappland. Während Inari zu Hause von einem alten Verehrer belagert wird, müssen die drei Jungs mit feindlichen Naturgewalten, übereifrigen Polizisten, Rentieren, verführerischen Killerlesben und schwerbewaffneten Russen fertig werden und beweisen, dass sie mehr als nur Lappen sind.
„Eine wunderbare Verliererkomödie“ (Stern)
„Durchgeknallt, turbulent und richtig komisch“ (Programmkino.de)
Jussi Awards: Beste Regie, Bester Film, Bestes Drehbuch und Peoples Choice Award
Alpe d‘Huez International Comedy Film Festival: Grand Prix Bester Film, Coup de Coeur
In Zusammenarbeit mit der Österreichisch-Finnischen Gesellschaft Vorarlberg anlässlich der 100 Jahr Feier Finnlands.
Verfilmung der gleichnamigen Erzählung von Hermann Hesse: Die Geschichte spielt im Mittelalter. Narziss und Goldmund lernen sich als Klosterschüler im Kloster Mariabronn kennen. Während der fromme Narziss sich den strengen Regeln des Konvents mit voller Inbrunst unterwirft, sieht der lebensfrohe und freigeistige Goldmund in den starren Vorschriften keinen rechten Zweck für sein Leben. Trotzdem versucht er, ein gelehriger Schüler zu sein. Zwischen den beiden entwickelt sich eine innige Freundschaft. Schließlich aber verlässt Goldmund das Kloster und begibt sich, von Narziss ermutigt, auf die Suche nach seiner Mutter, die einst die Familie verließ. So beginnt eine abenteuerliche Wanderschaft, bei der er in dem Dienstmädchen Lene auch seine große Liebe trifft. Er wächst zu einem Künstler heran, erlebt Freiheit und Glück, die Hölle der Pest, Leid und Tod. Erst Jahre später treffen die alten Freunde sich wieder, in einem dramatischen Moment ihres Lebens, der ihre Freundschaft auf die Probe stellt.
In Kooperation mit der Stadtbücherei Bregenz und der Vorarlberger Landesbibliothek